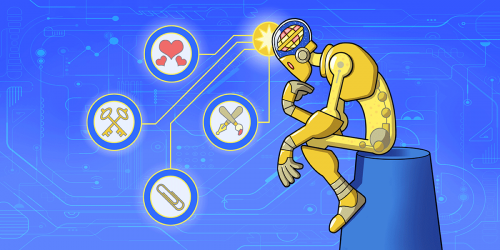Die Regierungen sollten die Menschen vor Cyberkriminalität schützen, und gleichzeitig die Menschenrechte achten und verteidigen. Weltweit missbrauchen Regierungen jedoch routinemäßig Gesetze zur Cyberkriminalität, um gegen die Menschenrechte vorzugehen, indem sie die Meinungsäußerung kriminalisieren. Die Regierungen behaupten, sie müssten dies tun, um unter anderem Desinformation, „religiösen, ethnischen oder sektiererischen Hass“, „Rehabilitierung des Nazismus“ oder „die Verbreitung falscher Informationen“ zu bekämpfen. Doch in der Praxis nutzen sie diese Gesetze, um Kritik und abweichende Meinungen zu unterdrücken und allgemein die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit zu beschneiden.
Daher ist es besorgniserregend, dass einige UN-Mitgliedstaaten einem Ausschuss von Regierungsvertreter*innen (dem Ad-hoc-Ausschuss), der von den Vereinten Nationen einberufen wurde, um über ein vorgeschlagenes UN-Abkommen über Cyberkriminalität zu verhandeln, vage Bestimmungen zur Bekämpfung von Hassreden vorschlagen. Diese Vorschläge könnten die Erniedrigung einer Person oder Gruppe oder die Beleidigung einer Religion über einen Computer zu einem Cyberverbrechen machen, selbst wenn eine solche Äußerung nach den internationalen Menschenrechtsvorschriften legal wäre.
Die Aufnahme in den Vertrag von Straftatbeständen, die auf schädlichen Äußerungen beruhen, anstatt sich auf die wichtigsten Cyberstraftaten zu konzentrieren, wird wahrscheinlich zu weitreichenden, leicht zu missbrauchenden Gesetzen führen, die rechtmäßige Äußerungen unterdrücken und eine enorme Bedrohung für das Recht auf freie Meinungsäußerung von Menschen auf der ganzen Welt darstellen. Der UN-Ausschuss sollte diesen Fehler nicht begehen.
Der Ad-hoc-Ausschuss der Vereinten Nationen traf sich Anfang dieses Monats in Wien zu einer zweiten Gesprächsrunde über den neuen Vertragsentwurf. Einige Mitgliedstaaten legten während und vor der Sitzung vage Vorschläge vor, die auf Hassreden im Internet abzielten, darunter Ägypten, Jordanien, Russland, Belarus, Burundi, China, Nicaragua, Tadschikistan, Kuwait, Pakistan, Algerien und Sudan. Andere machten Vorschläge, die auf rassistisches und fremdenfeindliches Material abzielten, darunter Algerien, Pakistan, Sudan, Burkina Faso, Burundi, Indien, Ägypten, Tansania, Jordanien, Russland, Belarus, Burundi, China, Nicaragua und Tadschikistan.
Jordanien schlägt beispielsweise vor, den Vertrag zu nutzen, um „Hassreden oder Handlungen im Zusammenhang mit der Beleidigung von Religionen oder Staaten über Informationsnetze oder Websites“ zu kriminalisieren, während Ägypten die „Verbreitung von Unruhen, Aufruhr, Hass oder Rassismus“ verbieten will. Russland schlug gemeinsam mit Weißrussland, Burundi, China, Nicaragua und Tadschikistan vor, ein breites Spektrum an vage definierten Äußerungen zu verbieten, um geschützte Äußerungen zu kriminalisieren: „die Verbreitung von Material, das zu illegalen Handlungen aufruft, die durch politischen, ideologischen, sozialen, rassischen, ethnischen oder religiösen Hass oder Feindschaft motiviert sind, die Befürwortung und Rechtfertigung solcher Handlungen oder die Bereitstellung des Zugangs zu solchem Material mittels IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)“ sowie „die Erniedrigung einer Person oder einer Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Rasse, Ethnie, Sprache, Herkunft oder religiösen Zugehörigkeit mittels IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)“.
Sprachdelikte gehören nicht in den vorgeschlagenen Vertrag zur Cyberkriminalität
Wie wir bereits gesagt haben, sollten nur Straftaten, die auf IKT abzielen, in den vorgeschlagenen Vertrag aufgenommen werden. Das umfasst z. B. solche Straftaten, bei denen IKT die direkten Objekte und Instrumente der Straftaten sind und ohne die IKT-Systeme nicht existieren könnten. Dazu gehören der illegale Zugang zu Computersystemen, das illegale Abhören von Kommunikation, Datendiebstahl und der Missbrauch von Geräten. Daher sollten Straftaten, bei denen IKT lediglich ein Werkzeug sind, das manchmal zur Begehung einer Straftat verwendet wird, wie die dem Ad-hoc-Ausschuss der Vereinten Nationen vorliegenden Vorschläge, von dem vorgeschlagenen Vertrag ausgeschlossen werden. Bei diesen Straftaten werden die IKT-Systeme nur zufällig einbezogen oder genutzt, ohne dass die IKT zum Ziel haben oder geschädigt werden.
Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) betonte im Januar, dass ein künftiger Vertrag über Cyberkriminalität keine Straftaten enthalten sollte, die auf dem Inhalt von Online-Äußerungen basieren:
„Gesetze zur Cyberkriminalität wurden dazu benutzt, die freie Meinungsäußerung durch die Kriminalisierung verschiedener Online-Inhalte wie Extremismus oder Hassreden übermäßig einzuschränken.“
Darüber hinaus sollten schädliche Äußerungen aufgrund der Schwierigkeiten, verbotene Äußerungen zu definieren, nicht in den Bereich der Cyberkriminalität aufgenommen werden. Hassreden, die Gegenstand mehrerer Vorschläge sind, sind ein treffendes Beispiel für die Gefahren, die durch die Aufnahme von sprachbezogenen Schäden in ein Cybercrime-Abkommen entstehen.
Da es keine allgemein anerkannte Definition von Hassrede in den internationalen Menschenrechtsgesetzen gibt, ist die Verwendung des Begriffs „Hassrede“ nicht hilfreich, um zulässige Einschränkungen der Redefreiheit zu bestimmen. Der Begriff „Hassrede“ kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben und ein breites Spektrum von Äußerungen umfassen, einschließlich schrecklicher, aber rechtmäßiger Äußerungen. Vage oder zu weit gefasste Gesetze, die Sprache kriminalisieren, können zu staatlich sanktionierter Zensur und Selbstzensur legitimer Sprache führen, da Internetnutzende im Unklaren darüber gelassen werden, welche Sprache nicht erlaubt ist.
Hassreden werden häufig mit Hassverbrechen verwechselt, eine Verwechslung, die bei der Ausarbeitung eines internationalen Vertrags problematisch sein kann. Nicht jede Hassrede ist ein Verbrechen: Einschränkungen der Redefreiheit können in Form von strafrechtlichen, zivilrechtlichen, administrativen, politischen oder selbstregulierenden Maßnahmen erfolgen. Obwohl Artikel 20 (2) des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte der Vereinten Nationen (ICCPR) klarstellt, dass jede „Befürwortung von nationalem, rassischem oder religiösem Hass, die eine Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt darstellt“, gesetzlich verboten werden muss, ist ein Verbot nicht unbedingt gleichbedeutend mit einer Kriminalisierung.
In der Tat sind strafrechtliche Sanktionen das letzte Mittel, das nur in den extremsten Situationen zum Einsatz kommt. Wie Article19.org erklärt, gehören zu den „schwersten Arten von Hassreden, die strafrechtlich geahndet werden können, die 'Aufstachelung zum Völkermord' und besonders schwere Formen der 'Befürwortung von diskriminierendem Hass, die eine Aufstachelung zu Gewalt, Feindseligkeit oder Diskriminierung darstellen'“.
Das internationale Recht bietet bereits genügend Anhaltspunkte für Äußerungen, die als Aufstachelung zum Hass eingeschränkt werden können, und sollte daher nicht in den Vertrag aufgenommen werden. Zusätzliche und widersprüchliche Bestimmungen über Hassreden im Internet im Vertrag über Computerkriminalität sind unnötig und unklug.
Breiter Schutz der freien Meinungsäußerung und sehr enge Beschränkungen der freien Meinungsäußerung
Im Mittelpunkt jeder Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung müssen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) stehen, dem die UN-Mitgliedstaaten, die den neuen UN-Vertrag über Cyberkriminalität aushandeln, beigetreten sind. Artikel 19 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte bietet einen umfassenden Schutz der Meinungsfreiheit. Er schützt das Recht, alle Arten und Formen der Meinungsäußerung über ein Medium seiner Wahl zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. Die Staaten dürfen diese Rechte nur unter sehr engen Umständen einschränken.
Artikel 19 Absatz 3 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte legt die Bedingungen fest, die jede Einschränkung der Meinungsfreiheit erfüllen muss: Sie muss gesetzlich vorgesehen sein („Rechtmäßigkeit“), der Erreichung eines legitimen Ziels dienen, in einem angemessenen Verhältnis zu diesem legitimen Ziel stehen und für eine demokratische Gesellschaft notwendig sein. In der Allgemeinen Bemerkung 34 des UN-Menschenrechtsausschusses wurde festgelegt, dass diese Standards auch für Online-Reden gelten. Tiefgreifend beleidigende Äußerungen, Blasphemie, Verleumdung von Religionen, Anstiftung zum Terrorismus und gewalttätiger Extremismus unterliegen nicht kategorisch zulässigen Beschränkungen. Jegliche Beschränkungen dieser Kategorien von Äußerungen müssen, wie die meisten anderen Kategorien von Äußerungen auch, die Anforderungen von Artikel 19 Absatz 3 erfüllen.
Sowohl der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf freie Meinungsäußerung als auch der Ausschuss für die Beseitigung rassistischer Diskriminierung (CERD) haben unterstrichen, dass das Verbot von Äußerungen den Anforderungen von Artikel 19 Absatz 3 genügen muss. Darüber hinaus muss es sich in erster Linie um zivilrechtliche Sanktionen handeln: Strafrechtliche Sanktionen sind das letzte Mittel, das nur in den extremsten Situationen, wie z. B. bei drohender Gewalt, angewandt wird. Die Allgemeine Bemerkung 34 des UN-Menschenrechtsausschusses und die Allgemeine Empfehlung 35 des CERD bestätigen ebenfalls, dass alle Beschränkungen der Meinungsäußerung dem Kriterium von Artikel 19 entsprechen müssen.
Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt: Der Standard
Obwohl die „Anstiftung“ eine Kategorie von Äußerungen ist, die derzeit eingeschränkt werden kann, bietet das bestehende internationale Recht genügend Anhaltspunkte dafür, wie die Staaten darauf reagieren sollten; ihre Aufnahme in den Vertrag über Computerkriminalität ist nicht erforderlich und würde nur Verwirrung stiften.
Wie bereits erwähnt, sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 20 Absatz 2 des IPBPR verpflichtet, das Befürworten von nationalem, rassischem oder religiösem Hass zu verbieten, der eine Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt aufgrund der folgenden Kategorien darstellt: Nationalität, Rasse, Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit, Sprache, Religion, nationale oder soziale Herkunft, politische oder sonstige Anschauung, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, Eigentum, Geburt, Behinderung oder sonstiger Status.
In seinem Bericht aus dem Jahr 2012 entwickelte der UN-Sonderberichterstatter einen Standard zur Beurteilung von Verboten nach Artikel 20, der sich auf Vorsatz, Aufwiegelung und besonderen Schaden konzentriert. Erstens muss der Redner die Absicht haben, öffentlich nationalen, rassischen oder religiösen Hass gegen eine bestimmte Gruppe zu befürworten und zu fördern. Als Nächstes muss die Rede „eine unmittelbare Gefahr von Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt“ gegen die Gruppenmitglieder hervorrufen. Schließlich muss die Aufstachelung darauf abzielen, Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt gegen die Gruppe zu erzeugen.
Um diese Standards auf nationaler Ebene zu erfüllen, haben die Mitgliedstaaten die folgenden Verpflichtungen:
- Verabschiedung präziser und eindeutiger Beschränkungen zur Bekämpfung der Befürwortung von nationalem, rassistischem oder religiösem Hass, der auf die Aufstachelung zu Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt hinausläuft. Gesetzliche Versuche, Hassreden zu bestrafen, sind oft zu vage oder zu weit gefasst. Es ist auch unklar, ob die Verbote der Staaten gegen „Befürwortung von Hass, die eine Aufstachelung darstellt“, unter Artikel 20 des ICCPR fallen oder tatsächlich auf legitime Äußerungen abzielen.
- Erlassen von Redebeschränkungen einzig und allein auf Grundlage legitimer Ziele gemäß Artikel 19 und 20 des ICCPR oder Artikel 4 des CERD. Zu den Grundsätzen der legitimen Ziele gehören die Achtung der Rechte und des Rufs anderer sowie der Schutz der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Gesundheit oder der Moral. Auch hier müssen die Beschränkungen eng zugeschnitten sein. Es muss ein dringender oder erheblicher Bedarf bestehen, und die Beschränkungen dürfen nicht zu weit gehen – ein Verbot von Redebeiträgen, weil sie kritisch sind, ist kein legitimes Ziel. Außerdem sollte der Schutz der Moral, die gesellschaftliche oder religiöse Traditionen widerspiegelt, nicht auf den Grundsätzen einer einzigen Tradition beruhen. Gemäß der Allgemeinen Bemerkung 34 des ICCPR sind Blasphemiegesetze, Redebeschränkungen, die eine bestimmte Religion bevorzugen oder benachteiligen, und Verbote von Kritik an religiösen Führern keine legitimen Ziele.
- Entscheiden Sie sich für Maßnahmen, die das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht unnötig und unverhältnismäßig einschränken. Wenn der Test nach Artikel 19 Absatz 3 erfüllt ist, müssen die Mitgliedstaaten nachweisen, dass die betreffende Rede eine unmittelbare Bedrohung darstellt und das am wenigsten einschneidende Mittel zur Einschränkung der Rede angewandt wird, um ein legitimes Ziel zu erreichen. Darüber hinaus muss die Absicht des Sprechenden, Schaden anzurichten, geprüft werden.
Dieser Test hat eine sehr hohe Schwelle, und viele Gesetze haben diese Standards nicht erfüllt. Das Gesetz über Hassreden in Myanmar enthielt eine unzulässig vage Definition des Straftatbestands der Hassrede. Spaniens Straftatbestände im Zusammenhang mit Meinungsäußerungen unterschieden nicht ausreichend zwischen der Schwere der Äußerung und der Auswirkung dieser Äußerung, um verhältnismäßige Sanktionen festzulegen, die mit Artikel 20 Absatz 20 und Artikel 19 Absatz 3 im Einklang stehen. Frankreichs Avia-Gesetz versuchte ebenfalls, gegen hasserfüllte Inhalte im Internet vorzugehen, wurde jedoch für verfassungswidrig erklärt.
Verbreitung von Desinformationen
Noch weniger Einigkeit herrscht über eine allgemeingültige Definition von Desinformation in den internationalen Menschenrechtsvorschriften. Desinformationsgesetze sind zu oft vage und zu weit gefasst und erfassen geschützte Äußerungen. Wie Human Rights Watch erläuterte, können „falsche“ Informationen heftig umstritten sein:
„Die Verbreitung von Desinformation, die die Menschenrechte untergräbt, und geschlechtsspezifische Online-Gewalt erfordern eine staatliche Reaktion. Staatliche Antworten auf diese menschenrechtlichen Herausforderungen, die sich auf die Kriminalisierung von Inhalten konzentrieren, können jedoch auch zu unverhältnismäßigen Einschränkungen der Rechte führen, insbesondere des Rechts auf freie Meinungsäußerung und des Rechts auf Privatsphäre.“
Alle Arten von Informationen und Ideen sind nach Artikel 19 des IPBPR geschützt, auch solche, die „schockieren, beleidigen oder stören” können, unabhängig davon, ob der Inhalt wahr oder falsch ist. Die Menschen haben das Recht, unbegründete Ansichten zu vertreten und zu äußern oder Parodien oder satirische Äußerungen zu teilen. Wie der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf freie Meinungsäußerung feststellte, ist „das Verbot von Falschinformationen kein legitimes Ziel im Rahmen der internationalen Menschenrechtsvorschriften“.
Der freie Fluss von Informationen ist ein wesentlicher Bestandteil der Meinungsfreiheit, die insbesondere bei politischen Äußerungen zu Themen von öffentlichem Interesse wichtig ist. Desinformationen, die absichtlich verbreitet werden, um sozialen Schaden anzurichten, sind zwar problematisch, doch der UN-Sonderberichterstatter betonte, dass dies auch für vage Strafgesetze gilt, die die Online-Rede behindern und den zivilen Raum einschränken.
Die Gemeinsame Erklärung über Meinungsfreiheit und „Fake News“, Desinformation und Propaganda aus dem Jahr 2017 enthält wichtige Grundsätze des internationalen Menschenrechts, die Staaten, Unternehmen, Journalist*innen und andere Akteure beim Umgang mit Desinformation unterstützen sollen. So werden die Mitgliedstaaten beispielsweise aufgefordert, ein günstiges Umfeld für die freie Meinungsäußerung zu schaffen, sicherzustellen, dass sie zuverlässige und vertrauenswürdige Informationen verbreiten, und Maßnahmen zur Förderung der Medien- und Digitalkompetenz zu ergreifen.
In der Resolution 44/12 erklärte der UN-Menschenrechtsrat, dass Reaktionen auf Desinformation immer den Grundsätzen der Legalität, Legitimität, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit entsprechen sollten. Wie bei Hassreden werden vage Verbote von Desinformation nur selten den Legalitätsstandard erfüllen. So schlug beispielsweise die gemeinsame Erklärung des UN-Sonderberichterstatters, des OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit und des IACHR-Sonderberichterstatters für Meinungsfreiheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wegen des Anstiegs von zu weit gefassten „Fake News“-Gesetzen Alarm (Human Rights Watch dokumentierte die Anwendung dieser Gesetze, und auch die EFF äußerte ihre Bedenken zu diesen Gesetzen).
Zum speziellen Thema der Desinformation bei Wahlen hat der UN-Sonderberichterstatter erklärt, dass Wahlgesetze, die die Verbreitung von Unwahrheiten im Wahlprozess verbieten, den Anforderungen von Artikel 19 Absatz 3 genügen können. Außerdem sollten solche Beschränkungen „eng ausgelegt, zeitlich begrenzt und so zugeschnitten sein, dass sie die politische Debatte nicht einschränken“.
Trotz dieser Warnungen wurden dem Ad-hoc-Ausschuss der Vereinten Nationen zahlreiche Vorschläge unterbreitet, die neue Straftatbestände für Fehlinformationen im Internet schaffen würden. Tansania schlug vor, die „Veröffentlichung von Falschinformationen“ zu verbieten. Jordanien schlägt vor, auch die „Verbreitung von Gerüchten oder falschen Nachrichten über Informationssysteme, Netzwerke oder Websites“ unter Strafe zu stellen. Russland forderte gemeinsam mit Weißrussland, Burundi, China, Nicaragua und Tadschikistan, „die vorsätzliche illegale Erstellung und Nutzung digitaler Informationen zu verbieten, die mit bereits bekannten und vertrauenswürdigen Informationen verwechselt werden können und dadurch erheblichen Schaden verursachen“.
Auch hier werden diese vagen Bestimmungen kaum den Menschenrechtsstandards genügen. Ihre praktische Auslegung und Anwendung wird sich nachteilig auf die Grundrechte auswirken und mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
Der Weg in die Zukunft - Ausschluss von Straftaten aufgrund des Inhalts von Online-Äußerungen
Die EFF schließt sich ihren Partnern an, darunter Artikel 19, AccessNow Priva und Human Rights Watch und fordert die UN-Mitgliedstaaten auf, inhaltsbezogene Straftaten aus dem vorgeschlagenen UN-Vertrag über Cyberkriminalität auszuschließen. In einem Schreiben an den Ad-hoc-Ausschuss der Vereinten Nationen warnten die EFF und mehr als 130 zivilgesellschaftliche Gruppen, dass Gesetze zur Cyberkriminalität bereits als Waffe eingesetzt werden, um Journalist*innen, Whistleblower, politische Dissidenten, Sicherheitsforschende, LGBTQ-Gemeinschaften und Menschenrechtsverteidiger*innen zu verfolgen. Die Mitgliedstaaten haben bei der Ausarbeitung eines globalen Vertrags keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten einen Konsens finden, um sprachbezogene Straftaten aus dem UN-Vertrag über Cyberkriminalität auszuschließen.